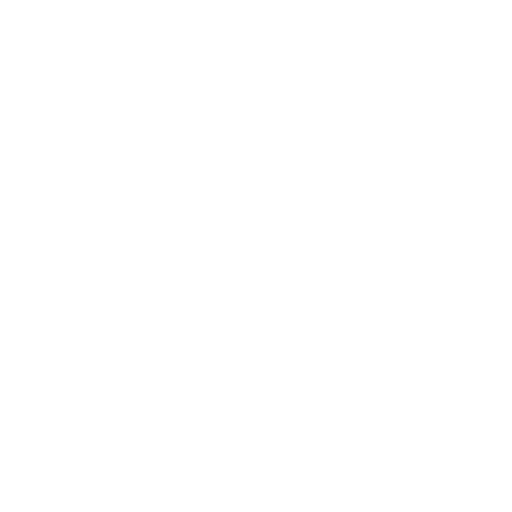Was ist Prozessintegration? In welchem Zusammenhang steht hierzu Rapid Process Design?
Axel Drengwitz: Der voranschreitende Ausbau des E-Governments erfordert eine Anpassung von nahezu allen Prozessen in der Öffentlichen Verwaltung. Die Analysen dieser Prozesse zeigen häufig, dass die Mitarbeitenden eine Vielzahl von IT-Systemen bedienen müssen. Nicht selten werden dabei einzelne Prozessschritte von drei oder vier IT-Anwendungen unterstützt. Dadurch entstehen Mehrarbeiten, die ihren Ursprung in der begrenzten Interoperabilität der IT-Anwendungen haben. Wenn über den gesamten Prozesslauf ein übergreifender Daten- und Kontrollfluss sichergestellt werden kann, findet eine Prozessintegration statt.
Die Methode eines Rapid Process Design erfordert den Einsatz einer Integrationsplattform. Diese beheimatet sämtliche Prozessdokumentationen. Darüber hinaus stellt sie zahlreiche technische Schnittstellen zur Verfügung, die einen übergreifender Daten- und Kontrollfluss ermöglichen. Gleichzeitig kann das Prozess Design unmittelbar auf der Plattform erfolgen. Das macht das Prozess Design „rapid“, also deutlich schneller als bei einem konventionellen Vorgehen. Der bisher erforderliche Transfer von Prozessmodellen in Zielsysteme entfällt und eine Dokumentation in Drittsystemen ist nicht mehr erforderlich.
Wie verändert das Projekte zur Prozessanpassung?
Tobias Link: Aus dem Blickwinkel der Organisationsentwicklung steht nicht im Mittelpunkt, dass Integrationsplattformen IT-Anwendungen miteinander verbinden. An den klassischen Phasen der Erhebung, Analyse und Soll-Konzeption ändert sich nichts. Soll in den Projekten eine Prozessintegration erfolgen, sind aus unserer Sicht verschiedene Fragen in einem Vorprojekt zu klären: Welche Prozesse sind geeignet für eine Automatisierung? Wie können sie auf geeigneten Plattformen abgebildet werden? Kann eine maschinelle Intelligenz genutzt werden? Und letztlich auch, welche der möglichen Plattformen für das spezifische Umfeld überhaupt geeignet ist.
Ergeben sich Vorteile für die Gestaltung der Organisation?
Tobias Link: Medien- und Systembrüche werden bereits „by design“ reduziert und Abläufe automatisiert. Schließlich werden die Akteure durch die Automatisierung von Routineaufgaben deutlich entlastet. Oftmals geht es bei der Einführung einer solchen Plattform auch um eine Verringerung der Anzahl von Softwarelieferanten. In diesem Fall wird eine „Trägerplattform“ für zahlreiche Verfahren geschaffen, was letztlich in mehrfacher Hinsicht wirtschaftlicher ist.
Befinden sich solche Plattformen bereits im Einsatz in der ÖV?
Drengwitz: Aus Sicht der öffentlichen Verwaltung ist das Thema nicht unbedingt neu. Diskussionen über das Workflowmanagement werden schon seit zwei Jahrzenten geführt. Sie finden praktischen Niederschlag zum Beispiel im Bereich der elektronischen Aktensysteme. Übergreifend, im Sinne einer Prozessintegration, wurde das Thema bisher jedoch nur ansatzweise betrachtet.
Andere Sektoren, wie z. B. das Versicherungs- und Bankenwesen, vertrauen schön länger auf diese Technologie und haben ihr Prozessdesign umgestellt. Auch „exotischere“ Beispiele, wie der Flughafen Heathrow zeigen, welche Leistungsfähigkeit diese Technologie besitzt.
Aber es gibt auch in der Öffentlichen Verwaltung schon positive Beispiele. Die Bayerische Staatsregierung etwa hat das Antragsverfahren für die Corona-Soforthilfe mit Rapid Process Design entworfen und auf einer Integrationsplattform umgesetzt. Innerhalb von wenigen Tagen konnte dadurch ein Verfahren bereitgestellt werden.
Was braucht die Verwaltung, um von Rapid Process Design profitieren zu können?
Drengwitz: Einerseits ist die Nutzung einer Integrationsplattform eine strategische Entscheidung und benötigt in den Projekten die uneingeschränkte Unterstützung der oberen Leitungsebene. Das Thema ist hier oftmals noch nicht angekommen. In den Projekten selbst muss durchaus noch viel neues Know-how gesammelt werden. Lernkurven müssen durchlaufen werden, um Routine für geänderte Vorgehensweisen, Methoden und auch Technologien zu erlangen.
Welches Ziel verfolgt die 2019 veröffentlichte Architekturrichtlinie des Bundes?
Christian Kiehle: Übergeordnetes Ziel ist die strategische und planvolle Weiterentwicklung der IT des Bundes. Diese unterliegt insbesondere technisch einem stetigen Wandel. Es soll vermieden werden, dass zum Beispiel bei der Neuvergabe von Aufträgen Entscheidungen getroffen werden, die technische Hürden aufbauen, die einer späteren IT-Konsolidierung im Wege stehen. Die Architekturrichtlinie macht dazu Architekturvorgaben, die dabei helfen, architekturrelevante Entscheidungen systematisch, transparent und nachvollziehbar zu treffen.
Welche sind die entscheidenden Neuerungen bzw. Unterschiede zur Vorgängerversion?
Christian Kiehle: Die Architekturrichtlinie des Bundes ist aus dem Standard SAGA 5 hervorgegangen bzw. hat SAGA vollständig abgelöst. Insbesondere der Anhang „Technische Spezifikationen zur Architekturrichtlinie“ konkretisiert die Architekturvorgaben insofern, dass sie zur Architekturrichtlinie konforme technische Lösungsbausteine beschreibt. Damit ist die Richtlinie ein unabdingbares Handwerkzeug eines jeden IT-Architekten, der ein IT-System für die Bundesverwaltung konzipiert und umsetzt.
Auf welchen Grundlagen baut die Richtlinie auf?
Christian Kiehle: Zentrale Aspekte der Richtlinie sind von bereits bekannten Konzepten beeinflusst, z.B. Netze des Bundes, Rahmenarchitektur IT-Steuerung Bund und der IT-Konsolidierung Bund. Dadurch wird sich jeder Architekt oder Entscheidungsträger in der öffentlichen Verwaltung schnell mit der neuen Richtlinie vertraut machen können. Insbesondere in Projekten mit Individualentwicklungsanteilen helfen die technischen Spezifikationen zur Architekturrichtlinie bei der Auswahl eines geeigneten Technologiestacks weiter. Dennoch ist nach wie vor die Richtlinie nicht an allen Stellen bekannt und wird nicht flächendeckend in dem Maße verpflichtend vorgeschrieben, wie dies aus Standardisierungssicht wünschenswert wäre.
Was bedeutet die neue Architekturrichtlinie für laufende oder neue IT-Projekte in den Bundesbehörden?
Christian Kiehle: Für laufende und neue Projekte bietet die Architekturrichtlinie des Bundes ein Begleit- und Richtliniendokument, das nicht nur für IT-Architekten äußerst relevant ist. Da die Architekturrichtlinie das Metamodell der Rahmenarchitektur IT-Steuerung aufgreift, kann die Richtlinie dazu genutzt werden, ganzheitlich auf IT-Projekte zu blicken und diese strategischen Zielen einer Behörde oder eines Ressorts zuzuordnen. Es werden übergreifende Architekturvorgaben ebenso gemacht wie Vorgaben zur geschäftlichen oder technischen Architektur.
Welche Gestaltungsspielräume gibt es im Rahmen dieser Vorgaben?
Christian Kiehle: Natürlich kann und soll nicht an allen Stellen standardisiert werden. Zahlreiche Anforderungen sind zu spezifisch, um sie standardisiert umsetzen zu können. Für solche Fälle sieht die Richtlinie durchaus vor, Umsetzungsalternativen zu evaluieren, und sie bietet eine Methode zur Entscheidungshilfe an. Somit kann auch im Falle einer Abweichung von den Vorgaben der Richtlinie transparent und nachvollziehbar dokumentiert werden, warum und wo abgewichen wurde. Dadurch können auch Systemanforderungen abgedeckt werden, die sich sehr spezifische Fragestellungen widmen, ohne das Ziel der Nachhaltigkeit aus den Augen zu verlieren.
Das BMI und das ITZBund haben einen Chatbot zum Corona-Virus entwickelt und bereitgestellt. Was leistet dieser Chatbot und was muss er dafür technisch können?
Christian Meyer: C-19, so heißt dieser Chatbot, deckt inhaltlich viele Aspekte rund um das Corona-Virus ab. Er beantwortet allgemeine Fragen zum Coronavirus, zu Reisen, Quarantäne, aktuellen Zahlen und der aktuellen Lage bis hin zu arbeitsrechtlichen Fragen oder Spezialthemen wie Tiertransporte.
Jan Engelke: Technisch hat uns der Chatbot vor ein paar Herausforderungen gestellt. Zum einen greift der Chatbot auf über 800 unterschiedliche Inhalte zurück und zum anderen kommen diese Inhalte von 10 unterschiedlichen Bundesbehörden. Der Chatbot identifiziert unter Einsatz von KI die richtige bzw. am besten passende Antwort auf die Frage eines Nutzers bzw. einer Nutzerin ist. Durch die Feinkörnigkeit und den Detailgrad der Inhalte sind die Unterschiede in manchen Fällen sehr gering. Mittlerweile schafft es Bot aber sehr gut, diese inhaltliche Nähe abzuschätzen und passende Antworten zu liefern. Dabei bietet der Chatbot nicht nur eine einzige Antwort an, sondern schlägt - falls inhaltlich ähnliche Antworten vorliegen - sogar mehrere Antworten vor, aus denen der/die Nutzende auswählen kann.
Wir haben im Auftrag des ITZBund ein System entwickelt, das von verschiedenen Redaktionen parallel mit Inhalten befüllt werden kann. Dieses System heißt BerND. Es ermöglicht, behördenübergreifend die Inhalte schnell und einfach fortzuschreiben. Zusätzlich enthält ein Chatbot im Vergleich zu einer Website auch einen Rückkanal, so dass Erkenntnisse aus den Fragen der Bürgerinnen und Bürger eine kontinuierliche Verbesserung der Kommunikation der Behörde ermöglichen.
Wo ist dieser Chatbot, Stand Dezember 2020, bereits zu finden?
Christian Meyer: Aktuell ist der Chatbot online beim Zoll, im Familienportal des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, BMFSFJ und an zwei Stellen auf den Seiten des Bundesministeriums des Inneren:
- https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
- https://www.bmi.bund.de/DE/service/kontakt/buergerservice/buergerservice-kontakt-node.html.
Die neue Informationsplattform wird gut angenommen. Mit Stand zu Ende des Jahres 2020 wurde monatlich ca. 300.000 Mal auf den Chatbot zugegriffen, davon wurden ca. 3.000 ausführlichere Dialoge pro Monat durchgeführt, in denen Nutzende im Durchschnitt 10 Fragen pro Gespräch an C-19 richteten und beantwortet bekommen haben.
Das bedeutet im Rückschluss, dass der Chatbot C-19 über 1.000 Fragen pro Woche beantwortet. Diese Zahlen entwickeln sich kontinuierlich nach oben, was uns sehr freut. Aufgrund der anhaltenden Informationsbedarfslage beim Thema Corona wird C-19 auch im Jahr 2021 durch das ITZBund betrieben. Es gibt übrigens auch einen Imagefilm vom BMI zu C-19 auf Youtube.
Können andere Behörden den Chatbot auf Ihren Webseiten integrieren und was müssen sie dafür tun?
Jan Engelke: Die Integration des Chatbots ist sehr einfach zu bewerkstelligen, letztlich muss dafür nur ein Link auf der eigenen Webseite der Bundesbehörde eingebunden werden und es sind keine weiteren Anpassungen in der Webseite selbst nötig. Fragen mit regionalem Bezug sind natürlich besser an die Landes- und kommunalen Behörden zu stellen.
Ist es geplant, den Chatbot C-19 mit weiteren Inhalten zu füttern?
Christian Meyer: Die Inhalte von C-19 werden laufend von den diversen bereitstellenden Häusern und Inhaltsgebern erweitert und aktualisiert. Auch werden alle Inhalte zusätzlich von einem zentralen Redaktionsteam in enger Zusammenarbeit/Abstimmung mit den Inhaltgebern auf einem aktuellen Stand gehalten Der Chatbot wird nicht nur laufend aktualisiert und technisch erweitert, sondern auch auf Grundlage der Fragen der Nutzer*innen immer weiter optimiert, um in Zukunft die Fragen noch besser und passender zu beantworten.
C-19 ist der Prototyp für den Chatbot-Basisdienst, den das ITZBund im Rahmen der IT-Konsolidierung Bund entwickelt. Was sind die nächsten Schritte, nachdem C-19 nun etabliert ist
Jan Engelke: In der Tat ist C-19 ein Prototyp, aus dem wir für ein umfassendes Konzept des Basisdienstes lernen wollen. Das ist bis jetzt schon sehr erfolgreich bzw. aufschlussreich. Zu Ende 2020 haben wir unsere Erfahrungen in Lessons Learned Workshops ausgewertet und entwickeln gemeinsam mit dem BMI und dem ITZBund in 2021 das Produkt des Chatbot Basisdienstes weiter.
Neben C-19 haben wir auch weitere Chatbots und sogar einen Voicebot als Prototypen entwickelt, darunter beispielsweise zum Thema Brexit.
Welche Rolle hatte und hat msg bei der Entstehung von C-19 und des Chatbot-Basisdienstes?
Christian Meyer: Die msg konzipiert und entwickelt auf Basis des Chatbot Frameworks RASA als umfänglicher Solutionprovider und auch mit der Plattform des msg Partners Neohelden alle Chatbots und die Funktionalitäten des Chatbot Basisdienstes. Dabei werden von uns von der technischen Seite bis hin zu konzeptionellen Fragen und redaktionellen Unterstützungen sämtliche relevante Bereiche rund um die Chatbots betreut.
Wir sind sehr froh und auch stolz darauf, dass uns das BMI als Kunde und das ITZBund als direkter Auftraggeber bei der konzeptionellen und technischen Entwicklung dieser Chatbots bis heute vertraut hat und freuen uns auf eine weitere kooperative Zusammenarbeit.
Warum muss sich die Arbeitswelt in der Öffentlichen Verwaltung verändern?
Maria Rösch: Die Erwartungen an die Verwaltung ändern sich, und zwar die der Bürgerinnen und Bürger, die sich mehr digitale Angebote und auch mehr Flexibilität wünschen, und auch die der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die anders arbeiten wollen. Gleichzeitig werden die Aufgaben, die durch die Organisation bewältigt werden müssen, komplexer. Einfache Aufgaben entfallen aufgrund der Automatisierung und Digitalisierung, und für die komplexeren Aufgaben werden „Wissensarbeiter“ gebraucht, die eine knappe Ressource sind. Auch deshalb muss die Verwaltung sich stärker auf die Ansprüche dieser Gruppe einstellen.
Bernd Gerbaulet: Und das bedeutet, dass ein Großteil der Aufgaben, die in den Behörden erledigt werden müssen, eine andere Organisation erfordern. Wissensarbeit braucht Zusammenarbeit, etwa in Projektteams, die die Aufgabe gemeinsam lösen. Das abteilungsübergreifende Arbeiten passt jedoch nicht in die bisherigen Kulturen und Aufbauorganisationen. Damit verbunden sind auch neue Anforderungen an Führungskräfte.
Was ist unter der Bezeichnung „New Work“ dann zu verstehen?
Maria Rösch: „New Work“ hat sich inzwischen zu einem Sammelbegriff (und auch ein wenig einem Modebegriff) für neue Formen der Zusammenarbeit entwickelt. Wir verstehen darunter eine neue kulturelle Entwicklungsstufe von Organisationen. Diese Entwicklungsstufe zu erreichen, ist dann angeraten, wenn sich eine Organisation und ihre Mitglieder in einem komplexen, nicht vorhersehbaren Umfeld bewegen. Die New-Work-Kultur ist geprägt vor allem von a) Selbstführung, b) der Integration neben den rationalen auch der emotionalen und körperlichen Seiten der Menschen – in der New-Work-Terminologie heißt das „Ganzheit“ – sowie c) dem Vorrang von Experimentieren gegenüber dem Planen. Verbunden mit der stetigen Orientierung am Kern-Zweck der Organisation ist dieser letzte Punkt, der „evolutionäre Sinn“, entscheidend für den Umgang mit einer sich schnell verändernden Welt. Die konsequente Ausrichtung am Zweck der Organisation ist aber tatsächlich die Basis für alle drei genannten Punkte. Alles, was man dann tut, um New Work zu etablieren, die Methoden und Vorgehensweisen, müssen daraufhin geprüft werden: Sind sie geeignet, Selbstführung, Ganzheit und evolutionären Sinn – mit Blick auf den Zweck der Organisation – zu fördern?
Welche Schritte müssen eingeleitet werden, um den Wandel zu beginnen?
Maria Rösch: Es gilt zunächst, zwei Grundvoraussetzungen zu klären: Veränderung ist eine Zumutung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daher braucht es gute Gründe, d.h. echte Schmerzpunkte innerhalb der Organisation. Nur dann entsteht genügend Energie, um den Wandel langfristig anzugehen und zu verfolgen. Diese Schmerzpunkte zu identifizieren, ist also der erste Schritt. Und als zweites geht es darum herauszufinden, ob Vorgehensweisen und Methoden aus New Work geeignet sind, die identifizierten Probleme zu lösen oder ob vielleicht klassischere Ansätze z.B. aus dem Prozessmanagement ausreichen oder gar besser passen. Wer New Work angeht, dem muss es ernst damit sein.
Bernd Gerbaulet: Wenn nach diesen Vorüberlegungen die Entscheidung fällt, dass es einer grundsätzlichen Neuorientierung bedarf, muss die „Saat der Veränderung“ ausgebracht werden, also kleine erste Veränderungen wie beispielsweise Meeting-Strukturen oder Entscheidungsmechanismen. Dann gibt es erste Mitarbeiter*innen mit Erfahrungswissen, die diese „Saat“ weitertragen, andere inspirieren können. Ein darauf aufbauendes Multiplikatorenprogramm kann ein wichtiges Element sein zur Ausgestaltung des eigentlichen Transformationsprozesses, der den Rahmen für die Veränderung stellt.
Was ist Euer Angebot an Behörden?
Bernd Gerbaulet: Wir begleiten einen Transformationsprozess hin zu „New Work“ mit Beratung, Coaching, Training und Moderation. Beratung heißt dabei beispielsweise, die Analyse der Herausforderungen, die Konzeption und Planung des Prozesses selbst und auch die Organisation seiner Umsetzung im Sinne eines Projektmanagements. Die Moderation beinhaltet etwa das Sichtbarmachen von Gruppendynamiken und auch die Vermittlung zwischen konträren Positionen. Wichtig dabei ist, dass der Zweck der Organisation stets im Fokus steht.
Maria Rösch: Coaching und Training adressieren die Befähigung der Beteiligten zur Veränderung. Coaching ist die konstruktive Begleitung von Führungskräften und Teams. Unser Training zielt auf die Selbstorganisation und die lösungsorientierte Kommunikation – von bzw. in Teams ebenso wie von Einzelpersonen.
Was gewinnt eine Behörde, die den Wandel vollzieht?
Bernd Gerbaulet: Durch die Fokussierung des Zweckes wird die Organisation insgesamt effektiver und effizienter. Mit der Entscheidung im Team und der situativen Verteilung von Verantwortlichkeiten werden die selbstgesetzten Ziele nachhaltig erreicht. Die Organisation gewinnt an Reaktionsfähigkeit und lernt konstant dazu. Über die neuen Formate entwickeln sich auch die Fähigkeiten der Mitarbeitenden stetig weiter.
Maria Rösch: Darüber hinaus werden die Stärken und Potenziale der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser genutzt, sie sind zufriedener – nicht zuletzt, weil der Zweck dessen, was sie tun, stets klar ist. Davon profitieren auch die „Kunden“ der Behörde. Und last but not least gewinnt die Behörde als attraktiver Arbeitgeber, die Mitarbeiterbindung wird erhöht und die Personalgewinnung erleichtert.
Wie profitiert eine Organisation bzw. eine Behörde von der Umsetzung der Barrierefreiheit?
Sebastian Bartsch: Tatsächlich ist die verbesserte Bedienbarkeit für Menschen mit Einschränkungen, der mit dem Begriff „Barrierefreiheit“ verbunden wird, der wichtigste, aber nur ein Aspekt. Damit werden die Services einem Personenkreis zugänglich, der sonst – etwa bei der Antragsstellung – individuell betreut werden müsste. Und auch viel mehr Arbeiten, die in der Behörde anfallen, können von Menschen mit Einschränkungen übernommen werden. Aber auch alle Benutzer der Website oder der Software, die keine Einschränkungen haben, profitieren von der höheren Benutzerfreundlichkeit. Barrierefreiheit trägt daher einerseits generell zu mehr Effizienz in der Arbeit bei, andererseits zu einer erhöhten Conversion-Rate online.
Judith Faltl: Darüber wirken sich Anwendung von Standards und eine normgerechte Programmierung auch auf den Betrieb und die Wartung der Software oder der Website aus. Und eine bessere Wartbarkeit senkt Kosten.
Ihr mahnt zu einer ganzheitlichen Sicht auf die Aufgabe Barrierefreiheit – was bedeutet das?
Judith Faltl: Wir meinen damit die Berücksichtigung von Barrierefreiheit schon in der Planungsphase eines Projektes. Fehler werden von Anfang an vermieden, während sie sich sonst gern im Verlauf wiederholen und am Ende mehrfach behoben werden müssen. Eine nachträgliche Implementierung der Barrierefreiheit kann dann schon mal ein Kostenvolumen erreichen, das an die Kosten für das Projekt selbst heranreicht. Wenn man das Thema von Beginn an mit verfolgt, bedeutet das hingegen einen Mehraufwand lediglich im niedrigen einstelligen Prozentbereich.
Sebastian Bartsch: Es geht aber nicht nur darum, Kosten zu reduzieren. Die Anforderungen der Barrierefreiheit bieten sehr gute Richtlinien für die Softwareentwicklung. Sind diese schon bei der Anforderungsanalyse berücksichtigt, können die Spezifikation und das Design sie zusammen mit den fachlichen Anforderungen umsetzen. Das hat zur Folge, dass die Software, wie gesagt, benutzerfreundlicher, strukturierter und damit auch wartbarer wird. Das reduziert auch den Aufwand in der Programmierung und im abschließenden Test. Und vor allem verbessert das insgesamt die Qualität der Software.
Was sind die ersten Schritte, wenn Ihr ein Projekt zur Sicherstellung von Barrierefreiheit startet?
Sebastian Bartsch: Zunächst gilt es, das Management abzuholen und zu sensibilisieren. Viele verbinden mit Barrierefreiheit eher etwas Negatives, vor allem einen hohen Mehraufwand. Die positiven Effekte sind meist gar nicht bekannt. Deshalb müssen alle ins Boot geholt werden, um die Anforderungen der Barrierefreiheit im Projekt fest zu verankern – bei allen Projektmitarbeitern, Projektleiter_in, Entwicklern und Testern gleichermaßen.
Für welche Bereiche muss Barrierefreiheit hergestellt werden und bis wann?
Judith Faltl: Mit einigen Ausnahmen, etwa Archive, ist aktuell der gesamte öffentliche Sektor betroffen. Zwar besteht die Verpflichtung, interne und externe Anwendungen barrierefrei zur Verfügung zu stellen schon länger. 2021 müssen jedoch erstmalig Berichte zum Stand der Barrierefreiheit erstellt und über mehrere Stufen bis auf EU-Ebene gemeldet werden. Der European Accessibility Act sieht allerdings auch für die Privatwirtschaft eine Verpflichtung zur Barrierefreiheit vor – und das schon bald. Bis zum Juni 2022 muss er in den Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt sein und drei Jahre später, Mitte 2025 also, auch flächendeckend angewendet werden. Ein Entwurf für Deutschland liegt bereits vor.
Wie können Behörden sich schnell einen groben Überblick verschaffen, was zu tun ist?
Judith Faltl: Eine gute erste Anlaufstelle ist die Bundesfachstelle Barrierefreiheit oder das Pendant auf Landesebene. Dort sind alle Informationen, auch jeweils aktuelle Informationen zu finden. Wir empfehlen Behörden, sich zunächst für ihre Websites mit der Mustererklärung zur Barrierefreiheit zu befassen und eine Kontaktstelle zum Melden von Barrieren einzurichten, um zu zeigen, dass sie das Thema aktiv angehen. Außerdem sollten sie dafür sorgen, dass auf der Startseite grundlegende Informationen in Gebärden- und in leichter Sprache ergänzt werden. Im Anschluss sollten sie ihre Webangebote auf Barrierefreiheit testen bzw. testen lassen und auf dieser Basis einen Zeit- und Umsetzungsplan für eine mögliche Optimierung des Angebots erstellen.
Sebastian Bartsch: msg entwickelt aktuell ein Verfahren, mit dem sich Behörden und Organisationen selbst einschätzen können. Dieses Verfahren berücksichtigt nicht nur die technischen Anforderungen, sondern zugleich organisatorische und übergreifende Themen. Auch hier sind wir bestrebt, das Thema ganzheitlich voranzutreiben und den Kunden bestmöglich zu unterstützen, schon bevor ein Projekt im eigentlichen Sinne beginnt.
Was können Behörden tun, um schnell eine Verbesserung ihrer Angebote zu erreichen?
Judith Faltl: Wie in jedem anderen Projekt auch gibt es bei der Umsetzung der Barrierefreiheit Artefakte, die viel Aufwand bedeuten und wenig Nutzen bringen, und solche mit geringem Aufwand und hohem Nutzen. Das gilt es zu analysieren und zu priorisieren. Verallgemeinern lässt sich das nur schwer. Grundsätzlich lässt sich aber sagen: Gute erste Schritte sind eine kontrastreiche Gestaltung und die durchgängige Bedienbarkeit mit der Tastatur. Alles, was zu hören ist, muss auch zu sehen sein und umgekehrt: Das heißt, Bilder und Videos brauchen einen beschreibenden Text, jedes Audio Untertitel oder Erklärungen in Gebärdensprache.